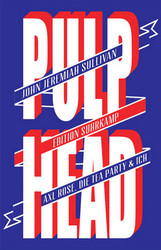John Jeremia Sullivan | Pulphead. Vom Ende Amerikas
Suhrkamp 2012
298 Seiten
20,00 €
ISBN 978-3-06890-8
von Lothar Schneider | Download
Das wirkliche erzählen.
Pulp im literarischen Sinne heißt Schund; ursprünglich bedeutet ‚Pulp‘ eine breiige Masse, insbesondere die Zellstoffmasse zur Papier- und Pappeherstellung. ‚Pulphead‘ wäre also eine Matschbirne oder, freier übersetzt, ein ‚Schrottkopp‘, aber die Nähe zum Trivialen einerseits, zum Literarischen andererseits und zum lustvollen Umgang mit beidem auf der dritten Seite bleibt unübersetzbar. Es war gut, der deutschen Ausgabe den Originaltitel zu belassen; der hinzugefügte Untertitel ist irreführend.
Diese Sammlung von fünfzehn Essays oder, wie es in deutschsprachigen Rezensionen gelegentlich auch heißt, ‚Reportagen‘ gehört, sowohl was ihre Form, als auch was ihren Inhalt betrifft, zu den meistgelobten US-amerikanischen Veröffentlichungen der letzten Jahre. Ihr Verfasser John Jeremia Sullivan wird mit Heroen des New Journalism wie Tom Wolfe, Hunter S. Thompson oder David Foster Wallace auf eine Stufe gestellt.
Dabei scheint der Gegenstand auf den ersten Blick zwar interessant und vielleicht sogar amüsant sein zu können, aber intellektuell nur wenig gewichtig: Sullivan schreibt über Phänomene der Gegenwartskultur wie populäre Musik (Michael Jackson, Axl Rose, Bunny Wailer, christliche Rockmusik) und mediale Wirklichkeiten (Reality TV, Disneyland, das Leben in Kulissen). Doch er berichtet auch aus einer Notunterkunft im zerstörten New Orleans sowie von einer Versammlung der Tea Party-Bewegung und unternimmt Ausflüge in die Geschichte und die Abseitigkeiten der Naturwissenschaft.
Auch wenn manche ‚Gegenstände‘ exzentrisch erscheinen, denunziert sie Sullivan nicht, gibt sie weder der Lächerlichkeit preis noch der pastoralen Kondeszendenz des wohlmeinenden – häufig deutschen – Intellektuellen. Als Nachkomme einer alten Kentucky-Familie mit bester Südstaaten Ausbildung hätte er dazu alle Voraussetzungen mitgebracht. Wie stark und persönlich diese Wurzeln sind, erzählt der preisgekrönte Essay Mr. Lytle über Andrew Lytle, einen der letzten Vertreter des Southern Movement, der atmosphärisch dichten, auf kultureller Eigenständigkeit insistierenden Literatur des amerikanischen Südens.
So wie Sullivan dem verqueren greisen Literaten seine Würde belässt, ohne dass die Präzision seiner Beschreibung leidet, so respektiert er in Der letzte Wailer auch den Reggae-Musiker und Rastafari Bunny Wailer. Selbst Axl Rose, ehemals Namensgeber und Sänger der Guns & Roses, der sich bei einem wiederholten Comebackversuch immer noch ungebrochen als Rockstar inszeniert, ist hier ‚jemand‘: Jemand der es geschafft hat, der Provinz zu entkommen. Und dies ist eine Leistung, denn das Zentrum von Indiana, in dem Rose aufwuchst, ist, wie der Verfasser berichtet, mehr als Provinz, es ist reine Leere. (Ein Video, in dem Sullivan die ersten zehn Seiten des Essays liest, findet sich auf youtube.)
In Pulphead erfährt man auch einiges über die präkolumbianische Mississippi-Kultur und über ihre Erforscher, über den ebenso genialen wie exzentrischen Naturforscher Constantin Rafinesque-Schmalz, der in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts nicht nur eine Reihe von Spezies erstmals beschrieb, sondern auch das Zahlensystem der Maya als erster entschlüsselte. Und Sullivan erzählt in einer kleinen Geschichte, wie sein Bruder fast durch einen Stromschlag getötet worden wäre.
Am interessantesten erscheinen mir drei Texte, die sich mit der medialen Konstitutionslogik unserer erlebten Wirklichkeit auseinandersetzen: Da ist zunächst das Erlebnis eines Besuchs in Disneyland, bei dem sich der Park als perfekt durchkonstruierte Welt für glückliche Kinder und bekiffte Väter herausstellt. (Wenn man die richtige App auf dem Smartphone hat!) Da ist zweitens die Beschreibung der irritierenden Erfahrung, die sich einstellt, wenn man sein Haus für eine Fernsehserie als Kulisse vermietet und dann erleben muss, wie die inszenierte Wirklichkeit in die hausgemachte einsickert. Höhepunkt des Bandes ist jedoch eine Reportage aus dem Milieu der Reality Shows: Sullivan begleitet den ‚Miz‘, eine Person aus einer solchen Serie, bei einem Auftritt in einem Nachtclub. ‚Auftritt‘ ist eigentlich zuviel gesagt, denn seine Performance besteht schlicht darin, anwesend zu sein. Dabei kritisiert Sullivan intellektuelle Reserven gegen dieses TV-Format und seine emphatische Vereinnahmung gleichermaßen:
„Es gab mal eine Zeit, in der die Leute gerne darauf hinwiesen, dass Reality-TV gar nicht wirklich echt war. [...] Es folgte eine Art deuxième naïveté, als die Leute überlegten, ob die Sendungen vielleicht doch etwas Reales hatten: Denn seien wir doch mal ehrlich: Dieser Narzissmus, das sind tatsächlich wir! Das ist eine Abbildung unserer Kultur![...] Ich würde allerdings behaupten, dass sie alle das wirklich Interessante an Reality-TV übersehen, nämlich die Art, wie es sich die Realität erfolgreich zu eigen gemacht hat.“ (S. 159)
Die Leistung Miz’ wie jedes Darstellers/Teilnehmers/Mitwirkenden der Kunstform Reality Show besteht darin, anwesend zu sein; seine Kunst liegt darin, anwesend zu sein und nicht zu schauspielern, während er doch permanent von Kamera- und Tonleuten umstanden bleibt. Sullivan sieht hier einen weitergreifenden „Wandel hin zu einem neuen Bewusstsein der eigenen Teilhabe an der Künstlichkeit des Ganzen“ (S. 160). Diese gesteigerte Sensibilität für die gleichzeitige Realität und Artifizialität derart beobachteter ‚Natürlichkeit‘ – Sartre hätte seine Freude daran! – ist für Sullivan längst dabei, die (welche?) Wirklichkeit selbst zu überlagern bzw. zur neuen Wirklichkeit zu werden. (Und wer würde ihm angesichts der ausgefeilten Begrüßungsrituale, wie sie bereits von Handtaschenmädchen und Schulhof-Dudes praktiziert werden, noch zu widersprechen wagen?)
Die Frage danach, was real ist und was erfunden (‚made up‘), was fingiert ist und was Fakten-gecheckt, zieht sich durch den gesamten Band. (Fact checkers sind eine wichtige Instanz der amerikanischen Reportagekultur; ihre Aufgabe ist, Material zu beschaffen und die inhaltliche Richtigkeit von Texten sicherzustellen.) In einer Geschichte (Das Treiben der Lämmer) z.B. erfindet Sullivan nach eigenem Eingeständnis einen Wissenschaftler auf der Suche nach – wie Sullivan versichert – wohl dokumentierten Phänomenen: den zunehmenden Angriffen von Tieren auf Menschen.
Eine wichtige Rezension von James Wood, die unter dem Titel Reality Effects in der New York Times (19. Dezember 2011) erschien, erkennt in Pulphead einen Gipfelpunkt des Neuen Essayismus, einer Strömung der angelsächsischen Gegenwartsliteratur, die sich von der fiktionalen Konstruktionslogik des Romans abwendet und ihr eine offene, zugleich faktengesättigte und narrativ vielgestaltige Erzählform gegenüberstellt. Woods nennt neben Sullivan vor allem Geoff Dyer als Autor. Seine Beschreibung erinnert zudem stark an David Shields Konzept des ‚lyric essay‘ in Reality Hunger. Ein Manifest (München: Verlag Ch. Beck 2011).
Was damit gemeint ist? Eine Form in der Tradition der großen amerikanischen Reportagen und Essays des New Journalism, eine Form, die Faktentreue und Erlebnisnähe beansprucht und sich dennoch aller literarischer Ausdrucksmittel bedient, die zugleich informieren will und fesseln. Dabei verwendet sie einen nach Auskunft der altweltlichen Handbücher für Journalisten höchst bedenklichen Kunstgriff: Die Stimme ihres Verfassers, der seinen subjektiven Erlebnissen im Prozess der Recherche Ausdruck verleiht. (Anthropologen nennen dies ‚teilnehmende Beobachtung‘.) Damit wird die autoritäre, unpersönliche Stimme des wissenschaftlichen Diskurssubjekts gleichermaßen erschüttert wie der geschlossene und geordnete Kosmos fiktionaler Textwelten. An ihre Stelle tritt ein Dialog zweier Individuen, ein Gespräch zwischen einem Geschichtenerzähler, der von seinen Abenteuern berichtet, und einem Leser, der ihnen nachzufühlen und sie zu verstehen versucht, sie aber nicht kritiklos übernimmt, sondern auch unterbrechen kann und sich Zeit nehmen, um mit eigenem Urteil und eigenem Gefühl auf das Erzählte zu antworten. Eine demokratische Form halt – und eine Form, die man zwar beschreiben kann, aber erfahren nur, wenn man sie liest. Und dies ist kaum besser möglich als in John Jeremia Sullivans Pulphead.
Über den Autor:
John Jeremiah Sullivan, geboren 1974 in Louisville/Kentucky, arbeitet als Reporter für das The New York Times Magazine, GQ, Harper's Magazine, die Paris Review und andere amerikanische Zeitschriften. Er lebt in North Carolina.