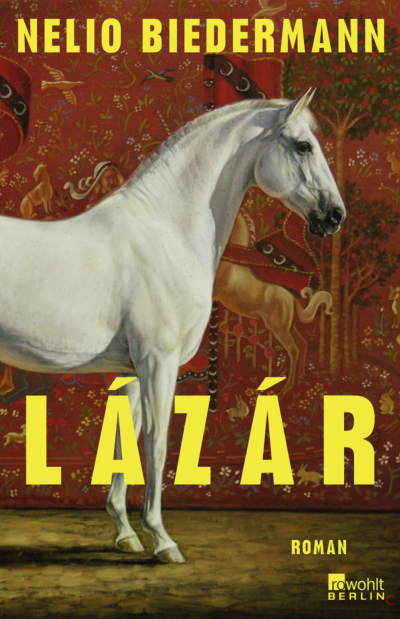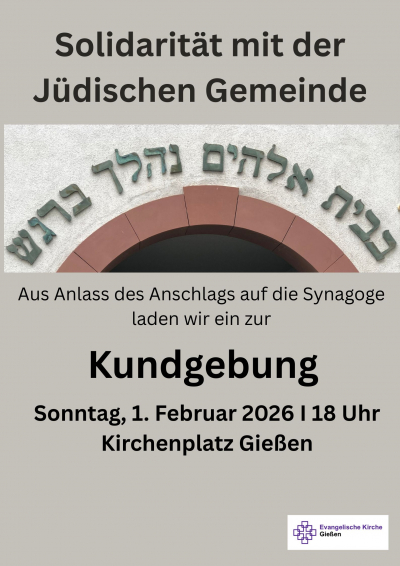Manfred Koch | Rilke – Dichter der Angst. Eine Biographie.
C.H. Beck
560 Seiten
34 Euro
ISBN 978-3406821837
von Lothar Schneider
Manfred Kochs Rilke-Biographie ist keine schnelle Lektüre: Sie nimmt sich Zeit für die Exposition und Raum für die Durchführung. Aber je weiter man voranschreitet und dabei zunehmend vertraut mit dem Dichter wird, um so spannender wird die Erzählung seiner gefährdeten Existenz im Übergang zwischen der traditionsbezogenen Welt des neunzehnten Jahrhunderts und deren Untergang in der beschleunigten Moderne des zwanzigsten.
Es handelt sich um eine klassische Biographie: Im Zentrum steht die Figur des Dichters, erzählt wird sein Leben, ummantelt von seinen Bekanntschaften, eingefügt in die Begebenheiten der Zeit. Da Rilke ein außerordentliches Netzwerk von Freundinnen und Freunden, Gönnerinnen und Gönnern und vielen weiteren gesellschaftlichen Kontakten unterhielt, mit denen er vorzugsweise brieflich kommunizierte, ergibt sich eine Hülle aus Texten, die über seine eigene Befindlichkeit, wie über die seines Umfelds und der Zeit breit und lebhaft Auskunft geben. Und da diese Briefe, zumindest von Seiten Rilkes, nicht nur sachliche Nachrichten sind, sondern eine Art von proto-literarischer Stilisierung erfahren, die zugleich der künstlerischen Selbstvergewisserung dient, entsteht ein lebhaftes Porträt des Dichters in seinem Umfeld, das zwanglos hinüberleitet zur Analyse der Werke, wie Koch an vielen Beispielen zeigt.
Rilke ist eine scheinbar widersprüchliche Person: Ein Mensch, der den Adel verehrte, der sich weite Strecken seines Lebens von Gönner zu Gönner, Schloss zu Schloss bewegte, der sich aber entschieden wie kein anderer deutscher Dichter dieser Zeit der Hauptstadt der Moderne, Paris, aussetzte; der sie hasste, floh, trotzdem ihre Erfahrung literarisch fruchtbar machte, an ihr zum einzigartigen Dichter reifte – und immer wieder kam. Adel stand Rilke für Tradition und Konstanz, Großstadt und Moderne für Unübersichtlichkeit, Hässlichkeit und Gefährdung.
Rilke, auch das wird in Kochs Biographie deutlich, war ein genuin moderner Mensch: Seiner Identität – auch seiner geschlechtlichen Identität – unsicher, zugleich nähebedürftig und bindungsängstlich, kommunikativ offen, dennoch zurückhaltend und stilisiert. Jemand, der seine Person als Kunstprodukt, als gelungene Formung seiner Ängste und seines Begehrens, verstand und in der Kunst die ästhetische Versöhnung der Dissonanz von Ich und Welt, das Erlebnis von Ganzheit und Geschlossenheit suchte. Der diese Künstlichkeit als eigentliches Ich verstand, das er zu leisten hatte und das er ausstellte: Rilke war narzisstisch im modernen Sinn. Wer Manfred Kochs Rilke-Biographie liest, wird auch einiges von sich begreifen.