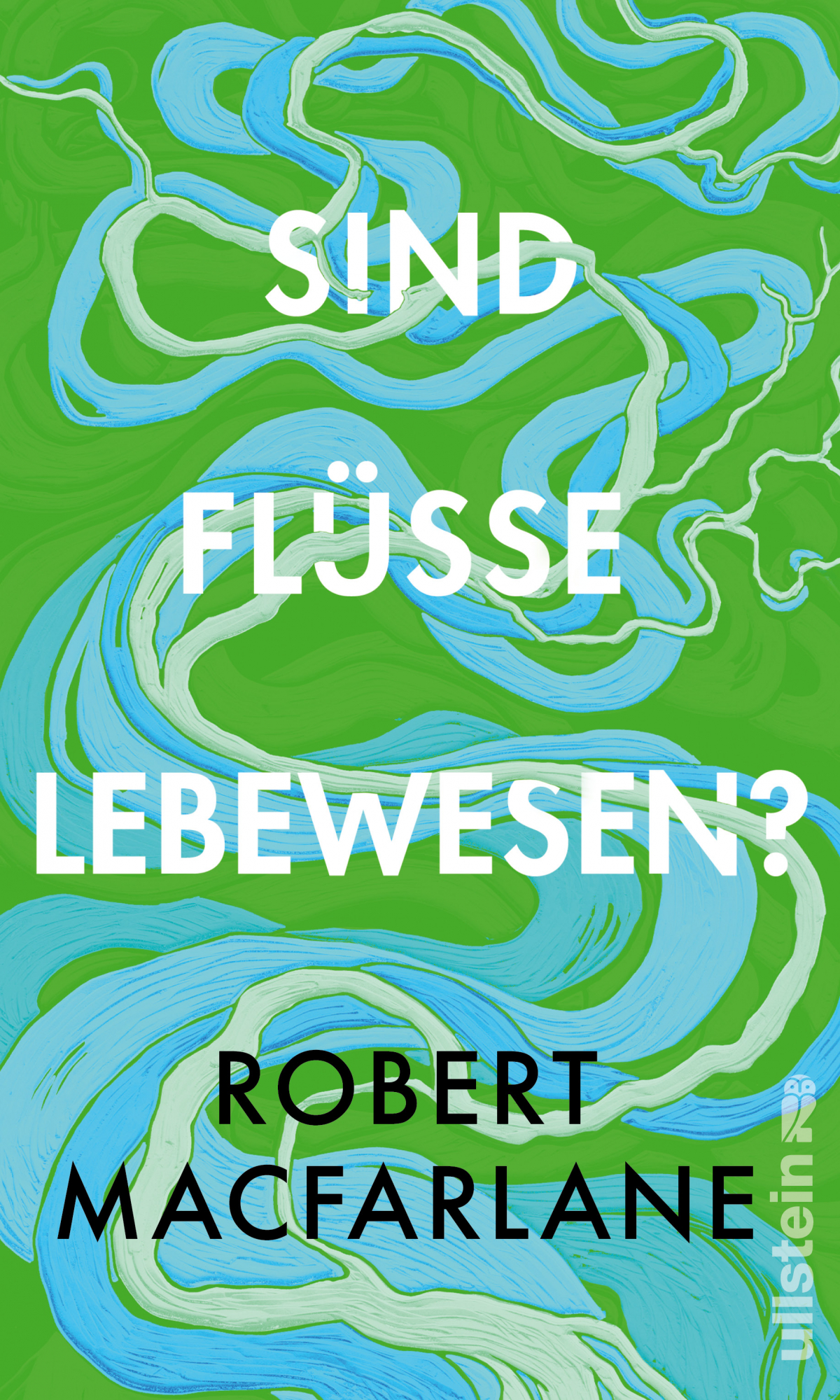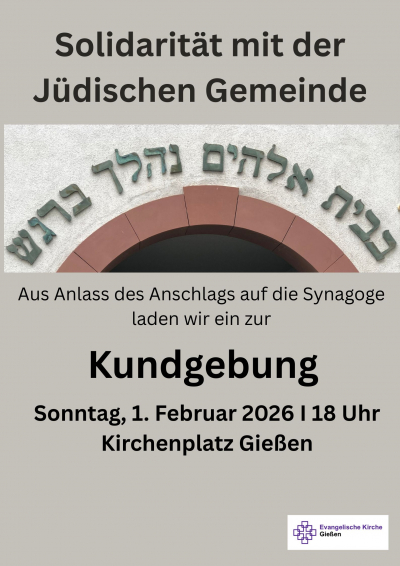Robert Macfarlane | Sind Flüsse Lebewesen?
Ullstein
416 Seiten
29,90 Euro
ISBN: 978-3-550-20250-6
von Lothar Schneider
Liest man Autorname und Titel, könnte man auf den Gedanken verfallen, es handele sich hier um eine etwas verrückte Idee eines spleenigen Engländers. Vielleicht hätte der Verlag dem vorbeugen können, indem er den Originaltitel Is a River Alive? mit Ist ein Fluss lebendig? übersetzt hätte, aber dann hätte wiederum die Gefahr bestanden, dass der Leserin oder dem Leser lustig springende Wasserläufe in den Sinn gekommen wären – und auch das wäre ein Mißverständnis.
Doch der Reihe nach: Robert Macfarlane ist der renommierteste Gegenwartsautor des Nature Writing, einer Literaturform, die in angelsächsischen Ländern großes Ansehen und große Popularität genießt, in Deutschland aber trotz allmählicher Akzeptanz immer noch auf Vorbehalte trifft. Dies mag verblüffen, verstehen sich Deutsche doch zumeist als naturverbunden. Aber unser Naturbild ist romantisch geprägt: Natur soll entweder gut und schön sein - und über die Unbilden und Fährnisse der gesellschaftlichen Existenz hinwegtrösten - oder groß und ewig – und eine Herausforderung darstellen, die es mannhaft zu überwinden gilt; auf jeden Fall aber soll sie vom Menschen ungestört sein, wenn sie schon nicht unberührt bleiben kann. Entsprechend wird von AutorInnen gefordert, dass sie Persönliches ausblenden und ganz im Erlebnis ihres Gegenstands aufgehen: Naturbeschreibungen sind kontemplativ, sollen die Natur-wie-sie-an-sich-ist darstellen.
Nature Writing hingegen kann alle nicht von Menschen gemachten Phänomene gleichwertig in den Blick nehmen, egal ob es sich um unberührte Wildnis oder um kurzlebige Pflanzen in den Spalten eines Bürgersteigs handelt; auch spielt die Person des Betrachters, spielen seine Reaktionen und Reflexionen eine wichtige Rolle. Schließlich stellt sich ihm die Frage, wie er das Vor-Augen-Stehende angemessen beschreiben kann. Es geht zunächst immer darum, den Gegenstand in seiner Fremdheit, Andersheit zu erfassen, zu begreifen, was ihm und nicht unserem anthropomorphen Blick geschuldet ist. Dies hat oft – und besonders hier – faszinierende Beschreibungen von großer Frische und Prägnanz zu Folge.
Sobald unsere Wahrnehmung von Natur problematisiert wird, stellt sich die Frage nach dem Umgang mit ihr. Nature Writing ist auch politisch. Macfarlane beschreibt drei Expeditionen entlang gefährdeter Flüsse: des Río Los Cedros im Nebelwald Ecuadors, den Bergbaukonzerne ins Auge gefasst haben; des durch Verschmutzung stark beeinträchtigten Adyar der südindischen Metropole Chennai und des Mutehekau Shipu – oder Magpie River – in der kanadischen Region Nitassinan, der durch Staudammprojekte bedroht ist. Allen gemeinsam ist ein starkes Engagement der Bevölkerung, das zu dem bemerkenswerten Resultat geführt hat, dass den Flusslandschaften juristische Persönlichkeitsrechte zuerkannt wurden. Dies stellt, wie Macfarlane klar macht, einen wichtigen Schritt zu einem schonenden Umgang mit der Natur dar, denn Persönlichkeitsrechte garantieren die Unversehrtheit ihres Trägers und schützen so die Flüsse und Landschaften gegen Nutzungs- und Ausbeutungsinteressen. Wem dies absurd erscheint: Auch juristische Personen wie z.B. Firmen und Organisationen verfügen darüber.
Und es gibt noch eine dritte Ebene des Textes. Macfarlane fragt sich: Wenn ich diese personalen Wesen als Organismen mit eigener Zeitlichkeit und eigener Räumlichkeit, als komplexen Zusammenhang selbst differenzierter Einheiten ansehe, wie finde ich trotz aller Andersartigkeit mit meinen sinnlichen und geistigen Mitteln einen Zugang zu ihnen? Was an mir ist ihnen ähnlich? Welche Modelle, welche Metaphern können ihre Eigenschaften nachvollziehbar machen, ohne sie zum bloßen Gegenstand zu reduzieren? Er zitiert seinen Freund Yuvan Aves, der vorschlägt, Lebendigkeit ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu stellen: »›Kinder werden als Animisten geboren, aber verlieren diese Fähigkeit irgendwann, Rob‹sagte er später, ›Oder besser gesagt, sie wird ihnen genommen. […] Was ist so ›seltsam‹ daran, rundum das Ausmaß und die Lebendigkeit des Lebens zu sehen – die vielen Leben, mit denen jedes einzelne unserer eigenen kleinen Leben verwoben ist? ‹« (S. 169). Macfarlane sucht eine »Grammatik der Lebendigkeit« (S. 213) – das Buch zeigt, wie sie aussehen könnte.