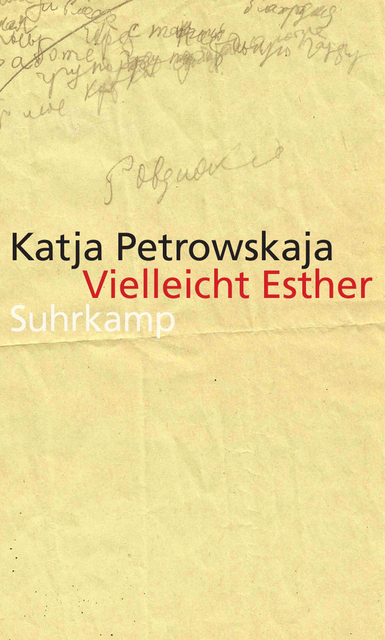Katja Petrwoskaja | Vielleicht Esther
Suhrkamp 2014
285 Seiten
19,95 Euro
ISBN 978-3-518-42404-9
von Mareike Ilsemann | Download
Russisch ist ihre Muttersprache. Aber als Literatursprache hat die 1970 in Kiew geborene Katja Petrowskaja Deutsch, die „Sprache der Täter“, gewählt. In ihrem Debüt Vielleicht Esther erzählt die in Berlin lebende Autorin und Journalistin außerordentlich ergreifend, aber überraschend leichtfüßig, die Geschichte ihrer jüdischen Familie. Es handelt sich um eine Familienrecherche, die Katja Petrowskaja vom Berlin der Gegenwart über verschiedene Schauplätze in Polen in die Vergangenheit bis ins Kiew des Jahres 1941 führt. Für das Kapitel, in dem die Autorin imaginiert, wie die Urgroßmutter, die vielleicht Esther hieß, von deutschen Soldaten in den Straßen Kiews erschossen wird, erhielt Katja Petrowskaja 2013 den Ingeborg Bachmann Preis. Noch nie ist die Geschichte einer jüdischen Familie im 20. Jahrhundert so literarisch dahergekommen. Es handelt sich um eine Familienrecherche, die, bei allen spürbaren Folgen der Vergangenheit über Generationen hinweg, auch einen Neuanfang darstellt.
Das Gefühl des Verlusts nimmt Katja Petrowskaja schon als Kind wahr. Sie vermisst so viele Verwandte. Fehlende Familienmitglieder sind im Kiew der 1970er Jahre aber nichts Ungewöhnliches. Meist handelt es sich um Kriegsopfer, die die sowjetische Gesellschaft zu Heroen stilisiert. Katja Petrowskaja erlebt als Sowjetkind die Fixierung auf eine Gegenwart, in der „die Verluste des Krieges einen unerschöpflichen Vorrat unseres Glückes bilden sollten, denn wir lebten nur, weil sie für uns gestorben waren, und wir sollten ihnen für immer dankbar sein“, schreibt die Autorin in Vielleicht Esther. Erst im Laufe der Jahre begreift Katja Petrowskaja, dass die fehlenden Mitglieder ihrer Familie nicht im Großen Vaterländischen Krieg gestorben sind.
Urgroßmutter Anna und Urgroßtante Ljolja „liegen“ in Babij Jar, heißt es in der Familie. Aber was bedeutet das? Die Namen „Rusja“ und „Jusek“ fallen. Auch sie sollen den „Bürgersteig mit der Zahnbürste“ geputzt haben, hört Katja als Kind. Damals kann sie diesen Satz nicht zuordnen und assoziiert die saubere Schweiz. Erst mit zunehmendem Alter ahnt Katja Petrowskaja, dass auch sie nicht „verschont geblieben sind“, Familienmitglieder im Holocaust verfolgt und ermordet worden sind. Jahrzehnte lang hatten die Eltern und Großeltern in der Sowjetunion ihre jüdische Identität verschwiegen, das Erbe nicht an die Kinder und Enkelkinder weitergegeben. Katja erfährt davon erst, als Tante Lida ihr ein Familienrezept mit einem Hinweis auf die jüdische Tradition vererbt. Zu den berührendsten Szenen dieses Buches gehört, wie Babuschka Rosa nach Jahrzehnten des Verdrängens zum ersten Mal wieder die jiddischen Lieder ihrer Warschauer Kindheit singt. Die Perestroika hat es möglich gemacht. Enkelin Katja hat Rosa von der ersten Auslandsreise nach Polen 1989 die entsprechende Schallplatte mitgebracht.
Die Verwandten wollen Katja Petrowskaja „ohne Gesichter, ohne Geschichten, wie Leuchtkäfer aus der Vergangenheit“ erschienen sein. Also hat sie angefangen, deren Lebens-und Sterbeumstände zu rekonstruieren. Manches lässt sich in Archiven nachlesen, Anderes erreicht Petrowskaja überraschend durch Zeit und Raum. Zum Beispiel klingelt am Silvesterabend 2011 bei den Eltern in Kiew das Telefon. Für Katja Petrowskaja ist es ein Anruf aus dem Jahr 1940. Denn die Anruferin, eine alte Dame aus Israel, entpuppt sich als ehemalige Kiewer Nachbarin. Der Vater schluchzt als erster auf. Alle anderen Bekannten der Generation haben nicht überlebt. Über das Internet stößt Petrowskaja auf entfernte Nachkommen in den USA und Großbritannien. Auf Ebay findet sich ein Foto des Hauses in Warschau, in dem Urgroßvater Ozjel einst eine Schule für taubstumme Kinder führte. Das Foto bringt den Nachkommen eines Wehrmachtsangehörigen bei der Versteigerung siebzig Euro ein. Eine Information, die einem den Atem stocken lässt. Von nüchtern bis tränentreibend, manchmal sogar komisch bereitet Katja Petrowskaja die Geschichten ihrer Familie in vielen kleinen Kapiteln auf. Sie ordnet die Unmenge an Stoff und die jahrelange Recherche als Wanderung von Berlin nach Kiew, durch die Schichten der Zeit und Historie an. Eine Wanderung durch die zerstörte Kriegslandschaft Osteuropas, in der die Vergangenheit bis heute spürbar ist. So wird in Warschau gerade ein Theaterstück über den Mord an den Juden von Jedwabne durch die polnischen Nachbarn aufgeführt. In einer polnischen Kleinstadt, in der ein Teil der Familie einst lebte, trampelt man auf jüdischen Grabsteinen herum. Man hat mit ihnen die Straße gepflastert. Petrowskaja ist eine fantastische Beobachterin, die permanent aussagekräftige Verbindungen herstellt.
Urgroßonkel Judas Stern erschoss 1932 in Moskau den deutschen Botschafter und wurde zum Tode verurteilt. Urahne Simon Heller gründete im 19. Jahrhundert in Wien das erste Internat für taubstumme Kinder. Über Generationen brachte die Familie mütterlicherseits gehörlosen Kindern das Sprechen bei. Katja Petrowskaja will sich an die Fakten gehalten haben. Nur da, wo es keine Zeugen und Beweise gibt, hilft ihr die Imagination. Die Urenkelin stellt sich vor, wie die gebrechliche Urgroßmutter voller Vertrauen ihren deutschen Mördern entgegen ging. „Ihr ging entwickelte sich wie ein episches Geschehen, nicht nur weil Vielleicht Esther sich wie die Schildkröte aus den Aporien von Zenon bewegte, Schritt für Schritt – langsam aber sicher“, heißt es in dem Kapitel, mit dem Petrowskaja die unbekannte Urgroßmutter als literarische Figur verewigt.
Die Grenzen zwischen den Ländern und die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart verwischen, die Geschichten der Familie Petrowskaja und der von Millionen europäischer Juden treten hervor. Vielleicht Esther ist eine Reflexion über die nicht nachlassende Wirkungskraft der mörderischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, in der das Überleben von Zufällen abhing. Es ist die Geschichte einer Selbstvergewisserung und eines Neuanfangs. Denn Katja Petrowskaja bestimmt sich nicht mehr durch die lebenden und die toten Verwandten und ihren Orten, sondern durch ihre Sprache, die sie hier so bildhaft, assoziativ, meisterhaft einsetzt. „Mein Deutsch, Wahrheit und Täuschung, die Sprache des Feindes, war ein Ausweg, ein zweites Leben, eine Liebe, die nicht vergeht, weil man sie nie erreicht, Gabe und Gift, als hätte ich ein Vöglein freigelassen“, heißt es in Vielleicht Esther.
Über die Autorin
Katja Petrowskaja, 1970 in Kiew geboren, studierte Literaturwissenschaft in Tartu (Estland) und promovierte in Moskau. Seit 1999 lebt sie in Berlin und arbeitet als Journalistin für russische und deutsche Print- und Netzmedien. Seit 2011 ist sie Kolumnistin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Für ihre Erzählung Vielleicht Esther erhielt sie den Ingeborg-Bachmann-Preis 2013 und war für den Preis der Leipziger Buchmesse 2014 nominert.
Mareike Ilsemann